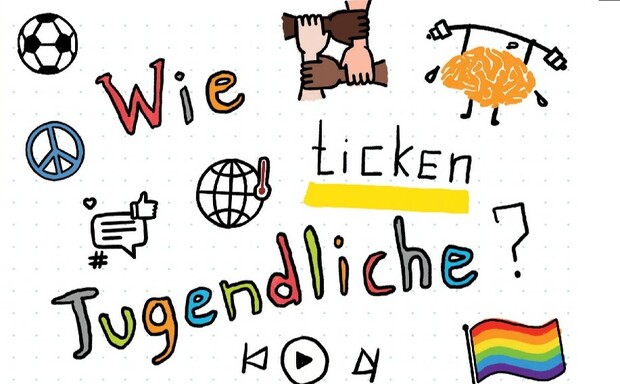Wie ticken Jugendliche?
Seit 2008 untersucht die SINUS-Jugendstudie „Wie ticken Jugendliche?“ alle vier Jahre die Lebenswelten 14- bis 17-jähriger Teenager in Deutschland. Die Fragestellungen hinter der Studie sind: Welche Themen sind der Jugendgeneration wichtig? Welche Herausforderungen sehen die jungen Menschen? Und wie blicken sie in die Zukunft? Die Studie untersucht zudem Meinungen, Einschätzungen und Wünsche zu Themen wie Politik, Gesundheit, Sport, Berufswahlprozesse sowie Wohlbefinden und Partizipation. Es werden Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebenswelten herausgearbeitet. Hierfür wird die lebensweltliche Vielfalt der Teenager in Deutschland typologisch zu einem wertebasierten Modell verdichtet.
2021 hat die DKJS beim „Takeover Bellevue“ drei Themen mitgenommen, die Jugendlichen auf dem Herzen liegen: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort. Schüler:innen können ihr Leben dort nicht mitgestalten. Digitalisierung ist in Schulen bisher unzureichend angekommen.
Um die Themen zu quantifizieren und differenzierter zu betrachten, haben wir sie in die SINUS-Jugendstudie 2024 eingebracht, wo sie in 72 qualitativen Interviews besprochen wurden.
„Für eine Gesellschaft ist es wichtig, zu wissen, was junge Menschen bewegt. Dafür müssen diese selbst zu Wort kommen dürfen und ernstgenommen werden. 2021 haben Jugendliche uns als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung beim “Takeover Bellevue” drei Themen mitgegeben, die ihnen auf dem Herzen liegen: Schule ist kein diskriminierungsfreier Ort, sie haben zu wenig Mitbestimmungsmöglichkeiten und Digitalisierung ist in Schule unzureichend angekommen. Die SINUS-Jugendstudie bestätigt dieses Bild. Wir nehmen das zum Anlass, die Themen, aufbauend auf unserer 30jährigen Erfahrung und gemeinsam mit unseren Bündnissen, weiter zu bearbeiten: Damit Schule der Ort wird, an dem alle gut lernen können.“Anna Davis, Leitung Programme
Schüler:innen fühlen sich machtlos
Die Mehrheit der Jugendlichen befürwortet das Wahlrecht ab 16 Jahren, auch weil politische Entscheidungen meist langfristige Auswirkungen haben und sie damit länger betreffen. Doch bereits in der Schule fühlen sich Schüler:innen nicht ernst genommen und bekommen wenig Mitspracherecht zugesprochen. Dabei legt eine Schulkultur, in der alle mitmachen dürfen, den Grundstein für aufgeklärte und engagierte Bürger:innen, die die Demokratie verstehen und aktiv mitgestalten.
… und im Stich gelassen
Nur die Hälfte der Jugendlichen fühlt sich wohl an der Schule. Die Schüler:innen berichten von Überforderung, Konflikten, Diskriminierung, mangelhafter Ausstattung und überforderten Lehrkräften. Hilfe wird selten innerhalb der Schule gesucht, stattdessen dienen Freund:innen und Familie als Rettungsanker.
Für viele Herausforderungen und Probleme scheint Schwänzen für die Jugendlichen eine weitverbreitete Antwort zu sein, unabhängig von Schultyp und Geschlecht. Die Gründe bleiben oft im Dunkeln, bewegen sich bei genauerer Nachfrage aber zwischen strategischem Schwänzen, um effizienter zu lernen, und Fernbleiben aus psychosozialen Gründen, z. B. Mobbing. Schwänzen bedeutet also nicht Faulheit.
Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche in ihren Problemen ernst zu nehmen und sie aufzufangen, bevor diese übermächtig werden. Im Bildungssystem muss dringend hinterfragt werden, warum innerschulische Unterstützungsstrukturen kaum genutzt werden, selbst wenn Schüler:innen sie als hilfreich beschreiben.
Ungleiche Chancen und Diskriminierung tief verwurzelt im Bildungssystem
Zwei von drei Jugendlichen sind der Ansicht, dass es in Deutschland keine gleichen Bildungschancen gibt. Dennoch haben vor allem die von der Ungleichheit Betroffenen die Vorstellung verinnerlicht, dass allein individuelle Leistung über ihren Bildungserfolg entscheidet.
Ebenfalls zwei Drittel der Schüler:innen berichten von Diskriminierungserfahrungen in der Schule (während außerhalb nur zwei von zehn Ähnliches erleben). Ob Herkunft, Aussehen, Geschlecht oder Religion als Auslöser, Schulen müssen alle Formen von Diskriminierung erkennen, thematisieren und bekämpfen, auch wenn sie von Lehrkräften ausgeht.
"Wenn Kinder und Jugendliche mitentscheiden, stärkt dies nicht nur ihr Selbstvertrauen, sondern auch ihr Verständnis von Demokratie. Sie lernen, eigene Meinungen zu bilden, sich zu engagieren, Entscheidungen mit anderen auszuhandeln – und dass ihre Stimme zählt. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung setzt sich seit 30 Jahren dafür ein, dass Kinder und Jugendliche ihre Lebenswelt gestalten können. In der SINUS-Jugendstudie spiegeln uns die befragten Schüler:innen aber ganz klar: Schule ist für sie kein Ort der Mitbestimmung. Sie fühlen sich nicht gehört und in ihren Belangen nicht respektiert. Das müssen wir ernst nehmen und gemeinsam mit den Verantwortlichen aus Politik, Schule und Verwaltung daran arbeiten, dass Beteiligung selbstverständlich ist."Anne Rolvering, Vorsitzende der Geschäftsführung der DKJS
Digitale Kluft in Schulen verstärkt Ungleichheiten
Trotz des DigitalPakts Schule bleibt die Digitalisierung der Schulen uneinheitlich und meist rückständig, unabhängig vom Schultyp. Jugendliche wünschen sich mehr digitales Engagement von Lehrkräften. Oftmals haben sie das Gefühl, die Lehrkräfte seien gegenüber digitalen Möglichkeiten nicht genug aufgeschlossen.
Die Mehrheit der Schüler:innen beklagen mangelnde Vorbereitung auf die digitalen Anforderungen der Arbeitswelt. Ohne einheitliche Förderung der Digitalkompetenzen in Schulen bleiben Jugendliche weiter abhängig von individuellen Voraussetzungen wie Zugang, persönliche digitale Affinität oder digitale Kompetenzen im sozialen Umfeld.
Die SINUS-Jugendstudie 2024 ist als gedrucktes Buch in der Schriftenreihe (Band-Nr. 11133, Bereitstellungspauschale 4,50 €) der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb erschienen. Sie steht auch als ePub kostenfrei zum Download bereit (siehe Info-Kasten).